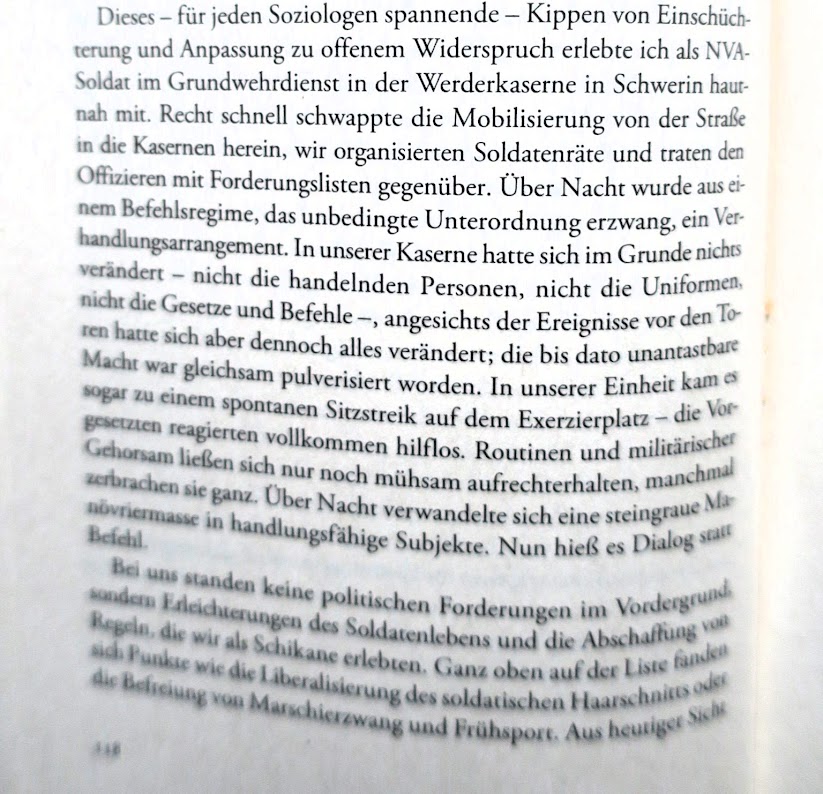Steffen Mau: Lütten Klein Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, Suhrkamp 2019
dazu auch: Youtube Interview
Einleitung, S.11 ff.
"Gab es in der Frühphase beachtliche Aufstiegsmobilität, so war die späte DDR durch eine starre Sozialstruktur und zunehmend verstopfte Pfade in die höheren Positionen gekennzeichnet. Sie war zudem eine eingekapselte und ethnisch homogene Gesellschaft, die kaum Erfahrung mit Zuwanderung gemacht hatte. [...]
Zudem fand sich die DDR-Bevölkerung über Nacht auf den unteren Rängen der gesamtdeutschen Hierarchie wieder und unterschichtete die westdeutsche Gesellschaft. Deklassierungs- und Entmündigungserfahrungen waren an der Tagesordnung, und dies zu einem Zeitpunkt, an dem man gerade zum ersten Mal die beglückende Erfahrung kollektiver Handlungsfähigkeit gemacht hatte. Es gab einen massiven Elitentransfair von West nach Ost – eine Überschichtung –, die wichtigsten Schaltstellen der ostdeutschen Teilgesellschaft wurden mit neuen, importierten Eliten besetzt." (S.15)
Lütten Klein (der Name stammt aus dem wendischen und bedeutet kleiner Ahorn,) ist der Ort, an dem ich aufgewachsen bin: [...] (S. 18)
1. Leben in der DDR, S.25 ff.
"Christoph Weinhold, der 1966 während seines Architekturstudiums als Praktikant nach Rostock kam, blieb und später, nach der Wende, Architekt der Hansestadt werden sollte, war einer der Planer der Neubauten im Nordwesten Rostocks. Lütten Klein hatte, so seine Einschätzung, "eine besondere Position im Kanon der Entwicklung des Städtebaus, gehörte es doch vom Planungsansatz und von der räumlichen Dimensionen her mit Hoyerswerda, Eisenhüttenstadt und Schwedt zu den ersten großen, durch Arbeitskräftekonzentration hervorgerufenen Stadt- und Stadtteilplanungen." Das Vorhaben wurde auch in den anderen sozialistischen Ländern aufmerksam zur Kenntnis genommen und fand Eingang in zahlreiche Standardwerke zur sozialistischen Baukultur. Im Vergleich zu vielen Altbauten, die auf dem technischen Standard der Jahrhundertwende verharrten, war die Wohnqualität hier von "konkurrenzlose(r) Attraktivität. Die Wohnungen gelten als komfortabel, da sie mit Fernwärme und nicht/mit Kohlöfen beheizt wurden, warmes Wasser aus den Hähnen kam und alle lebensnotwendigen Infrastrukturen vor Ort vorhanden waren." (S.27/28)
Die "Platte" versammelte alle Schichten, alle Berufsgruppen und stellte durch die standardisierten Lebenslagen und die geringe Varianz der Lebensformen Kohäsion zwischen unterschiedlichen sozialen Fraktionen her. Sie beseitigte Trennungslinien zwischen akademisch Qualifizierten, Facharbeitern, Angestellten sowie Un- und Angelernten und schuf an schichtenübergreifendes respektables soziales Milieu.
Unsere Nachbarn im Hochhaus waren Diplom-Ingenieurinnen, Bäcker, Stahlschiffbauer, Lehrerinnen, Straßenbahnschaffner, Opernsänger, Sprachwissenschaftlerinnen, Seemänner, Sparkassenangestellte, Bauzeichnerinnen, NVA-Offiziere. Selbst Universitätsprofessoren, das Leitungspersonal sozialistischer Betriebe und höre Politfunktionäre wohnten bei uns im Viertel. So konnte man – ohne dass dies in irgendeiner Weise als falsche Fraternisierung mit dem Volk der Werktätigen angesehen worden wäre - den Direktor einer Rostocker Werft aus einem Plattenbau herauskommen und in einen dunkelblauen Wolga mit Chauffeur einsteigen sehen." (S. 37)
Die Wohnraumbewirtschaftung unterlag politischen Maßgaben und keine ökonomischen Regulierung über den Mietpreis oder einen Markt. Quadratmeter Preise von 80 kündigen bis 1,20 DM der DDR und Energiepreise, die deutlich unter den Erzeugungskosten lagen/bedeuteten dass die DDR ihre Muster viertel heftig subventionieren musste. Die Furcht, bei einer Anhebung der Preise und eine Annäherung an die realen Kosten von den Bürgern abgestraft zu werden, war zu groß. Dafür klopfte man sich oft und gerne auf die Schulter. In der Ostsee Zeitung, dem SED Blatt des Bezirks Rostock, war im August des Jahres 1989 folgender Lobgesang auf die niedrigen Mieten zu lesen:
Für die Bürger der Republik ist es von großer Bedeutung und ein Markenzeichen sozialistischer Wohnungspolitik, dass sie seit mehr als 40 Jahren stabil sind. Etwa 3 % vom netto Einkommen eines Arbeiter – und Angestellten Haushalt werden dafür verausgabt. Die Mieten decken rund ein Drittel der Bewirtschaftungskosten, die anderen zwei drittel werden Tim Staatshaushalt finanziert. Zwischenraum der Vollständigkeit halber und nicht wegen der Polemik sei angemerkt, dass der Anteil der im Wohnungsmieten an Familieneinkommen in der BR D bis zu 50 % beträgt [...]. Seite 37/38
Die in den Neubaugebieten Stein gewordene Wohnungspolitik der DDR verschrieb sich einem Leitbild, dass auf Vereinheitlichung setzte. Damit wurde ein städtebaulich verankert es Bezugssystem für die durch die Bürger zu erfüllenden gesellschaftlichen Rollen geschaffen, dass auf zusammenfügen und Konformismus, nicht auf aus Differenzierung und Individualisierung ausgerichtet war. Zwischenraum die größeren Betriebe waren in dem Wohnviertel präsent Zwischenraum auch andere staatlich Mandat kollektive wie Eltern Kollektiv in der Schule bis hin zur Hausgemeinschaft – waren fester Bestandteil des Alltagslebens. Die fungierten als erweiterte Sozialisationsagenturen, die auf die Einbindung der Menschen achteten und/das Leben jenseits der Arbeit nahezu konkurrenzlos bewirtschafteten. In den Häusern wurden Verantwortliche gewählt, es gab ein Hausbuch, in das sich Bewohner und Gäste eintragen mussten, die Flurwoche war üblich.[...]" (S. 38/39)
"Das Umpflanzen einer großen Zahl von Menschen in die sozialistischen Wohnkomplexe sollte auch die aus den Herkunftskontexten mitgebrachten Verhaltensweisen und Eigensinnigkeiten zurückdrängen. Von dieser Sozialökologie des Wohnens versprach man sich nicht weniger als einen Persönlichkeitswandel, der jeden einzelnen auf seine gesellschaftliche Rolle festgelegte und damit einen mehr oder weniger freiwilligen Verzicht auf Extravaganzen und Widerspruch bestärkte, so dass sich staatliche Nachstellungen und die Drohkulisse der Sicherheitsorgane vielleicht nicht erübrigten, aber doch weniger notwendig erschienen." (S. 40)
"Die Unterschiede in den Wohnformen waren zunächst äußerlich, aber es gab auch etwas im Habitus der Bewohner, dass die Altbaumenschen von uns unterschied. Dazu trug sicher auch die soziale Selektivität derer bei, die sich vorstellen konnten, in einem auf der grünen Wiese aus dem Boden gestampften Neubauviertel zu leben. In der Altstadt wohnten in der Mehrzahl ältere Leute, Studierende und die Reste des Bürgertums. Richtige Bürgerkinder aus der Innenstadt traf ich erst als ich anfing, als Jugendlicher ins Volkstheater Rostock zu gehen und dort am Jugendklub teilzunehmen. Allerdings war das "Refugiumsbürgertum", das man an den Elbhängen Dresdens oder in einigen Teilen Berlins besichtigen konnte, in der Hafenstadt Rostock trotz langer Universitätstradition eine allenfalls randständige und kleine Gruppe. [...] Das gesellschaftliche Modell der Plattenbausiedlung zielte auf die soziale kulturelle Integration der Werktätigen, ihr sozialer Ertrag bestand in der Schaffung respektabler und selbstbewusster Milieus, in denen soziale und auch kulturelle Unterschiede weitgehend abgemildert waren." (S.42)
"Fragt man ehemalige DDR – Bürger heute, welcher sozialen Errungenschaft sie nachtrauern, so nennen viele die im Vergleich zur Bundesrepublik geringere soziale Ungleichheit. Zwar findet man kaum jemanden, der sich für ein System der absoluten Gleichheit ausspricht, aber ein engeres bei bei einander stehen der sozialen Gruppen und eine relative Gleichheit der Lebensverhältnisse werden als positiv empfunden. Zwischenraum die DDR hat zwar nicht die klassenlose Gesellschaft eingeführt, sich aber doch daran gemacht, gravierende materielle Ungleichheiten zu beseitigen." (S. 43)
"Die Erinnerung an die DDR-Gesellschaft trügt allerdings nicht vollends, auch wenn sie nur einen Teil der Verhältnisse spiegeln mag. In der DDR spielte die normative Selbstbindung an gesellschaftliche Gleichheitsziele eine große Rolle, der erreichte Grad an sozialer Egalität galt sogar als Fortschrittsmaß der sozialistischen Gesellschaft. Die DDR hat zwar nicht die klassenlose Gesellschaft eingeführt, sich aber doch daran gemacht, gravierende materielle Ungleichheiten zu beseitigen. Die Enteignungswellen in der sowjetischen Besatzungszone und in den ersten Jahren der DDR, die Verstaatlichung großer Bereiche /sowie die begrenzten Möglichkeiten der Vermögensbildung wirkten der Entstehung von Besitzklassen im Sinne des Soziologen Max Weber entgegen. Das Eigentum an Immobilien, Luxusgütern oder Produktionsmitteln war kein hervorstechendes gesellschaftliches Differenzierungskriterium, dass eine Statusordnung begründet hätte. Als privilegiert galten diejenigen, denen ein Häuschen an der Ostsee gehörte oder zugeschanzt wurde. Wer sich jedoch von anderen absetzen wollte, wurde schnell mit Konsumengpässen konfrontiert, dem uniformen Angebot und der begrenzten Produktpalette. In wichtigen Bereichen, etwa im Wohnungswesen, beim Zugang zur Urlaubsplätzen oder bei der Bildung, spielte Geld nur eine untergeordnete Rolle und wurde von anderen, eher politischen Distributionsmodi überlagert. Was in der Erinnerung als Gesellschaft der Gleichen erscheint, war eine nach unten hin nivellierte Gesellschaft." (S. 43/44)
"Gerade weil viele Mitglieder des Führungszirkel selbst als einfachen Milieus stammten, versuchten sie, den Anschein eines gesellschaftlichen Gefälle zu vermeiden, und verknappten den Zugang zu Hörer Bildung und hören Qualifikationen. Gegen den internationalen Trend kräuselte die DDR den Ausbau von erweiterten Oberschule und Universitäten." (S. 53)
"Alltagskulturell blieb die Funktionskaste im Grunde ihrem Herkunftsmilieu verbunden: Sie war zwar machtstark, aber kulturarm.". (S. 65)
2. Transformationen, S.113 ff.
Zusammenbruch und Übergang, S.113 ff
Endlichkeit einer Gesellschaftsform S.113 ff
"Albert O.. Hirschman [...] hat drei Strategien unterschieden, wie Menschen reagieren, wenn sie mit einem System nicht länger zufrieden sind: exit (Abwanderung), voice (Widerspruch) und loyalty (Loyalität). Zwar übte sich zunächst nur ein kleiner Teil der DDR-Bürger in aktiver Opposition, aber die Bereitschaft, Unzufriedenheit und Zweifel zu äußern (voice) nahm insgesamt doch zu. Im Sommer 1989 begann dann die Flucht und Ausreisewelle über Ungarn und die Prager Botschaft (exit), doch auch sie bremste den erwachenden Widerspruchsgeist nicht spürbar ab. [...] Die Massenloyalität schmolz rapide dahin, das System reagierte zunächst mit einer Mischung aus barscher Gegenwehr und rhetorische Überhöhung gesellschaftspolitischer Fernziele, dann mit Zugeständnissen und Reformversprechen. Allerdings verschliss sich diese Melange nach und nach. (S. 116)
Zerfallserscheinungen (S.117 ff.)
"[S.118: ]Ab einem gewissen Punkt hatten dann viele das Gefühl, es sei tatsächlich möglich, der Führung durch einen stummen Protestzug durch die Innenstadt Zugeständnisse abzuringen. .Dieses – für jeden Soziologen spannende – Kippen von Einschüchterung und Anpassung zu offenen Widerspruch erlebte ich als NVA-Soldat im Grundwehrdienst in der Werder Kaserne in Schwerin hautnah mit. ...
2. Blaupause West, S.133 ff.
Der Organisierungsgrad der Parteien war weit geringer als im Westen. "Einzig die Linkspartei war mit einem festen Wählerstamm im Osten von Anbeginn verankert, wobei die Mitglieder Basis durch das Wegsterben der Älteren immer schmaler wird. Die AfD beginnt seit einiger Zeit, mehr und mehr Mitglieder einzusammeln – Ende 2018 waren es in Mecklenburg-Vorpommern schon über 750, die angegebene Zielmarke ist 1000. Schaut man auf die Ergebnisse der letzten Europawahl im Mai 2019, scheint die AfD auf dem Weg zur ostdeutschen Regionalpartei, die die traditionellen Volksparteien zum Teil überholt." (S.145) [Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen 2023 zeigten freilich auch im Westen in dieselbe Richtung.]
"Die Wiedervereinigung steht, so gesehen, für eine Unternutzung des demokratischen Potenzials der friedlichen Protestbewegung und für eine Übernutzung des nutz nationalen Potenzials politische Mobilisierung. Den Lohn ehemaligen DDR Bürgern wurde zu verstehen gegeben, dass ich ihre Stellung und ihr Status vor allem vom Deutsch – sein ableitet und nicht auf ein Republikanisches Verständnis der Mitglieder schafft zurückgeht. Angesichts des Verlustes der Heimat DDR und der gleichzeitigen kulturell – politischen Entwertung dieser Identitätsressourcen nimmt es nicht Wunder, dass ich viele ostdeutsche bereitwillig auf dieses neue Identitätsangebot einlesen. Die DDR war keinesfalls frei von nationalen Anwandlungen, im Prozess der Vereinigung wurden diese Leidenschaften aber weiter versiert und identitätspolitisch aufgeladen (S. 149)